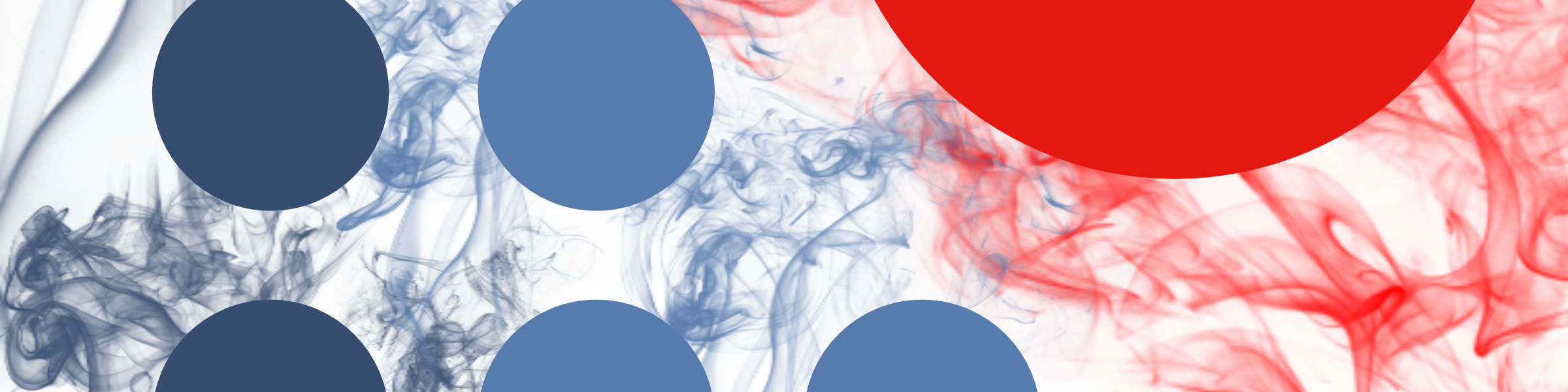In der Zeitschrift Schulverwaltung : Zeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement wurde in Ausgabe 3/2009 ein Artikel von Klaus Kuhlmann, Gründungsmitglied von schulpsychologie.de, veröffentlicht. Supervision für Lehrer:innen, ein damals wie heute aktuelles Thema.
Zur Angleichung an die Konventionen zur Beachtung der Geschlechtervielfalt unserer Seite, haben wir diese im Artikel angepasst.
Beziehungsdiagnose
Warum Supervision für Lehrerinnen und Lehrer?
Wenn es um die Teilnahme an einer Supervisionsgruppe geht, dann kann man von Lehrpersonen oft hören, dass man sowieso schon bis an die Grenze belastet sei und man die verbleibende Zeit dringend zur Regeneration brauche. Also auf keinen Fall noch zusätzlich Zeit und Arbeit brauche, obwohl man sehr gerne an einer solchen Gruppe teilnehmen würde. Ein sehr verständlicher Gedanke?
Klaus Kuhlmann, Schulpsychologe, Köln
»Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir«, ein Spruch, den Erwachsene gerne nutzen. Müsste es stattdessen nicht besser heißen: Weder für die Schule noch fürs Leben lernen wir, sondern entweder für uns selbst, weil uns etwas interessiert, oder zur Aufrechterhaltung unserer Beziehungen. Jedem Leser werden Schulsituationen einfallen, wo es Eltern, Lehrer:innen oder Freunden gegenüber peinlich war, eine Note geschrieben zu haben, die nicht ins Bild passte bzw. die nicht dem entsprach, was sich dieser Personenkreis wohl von mir erwartet hatte.
Bedeutung von Beziehungen
In diesem Sinne könnte man also obigen Spruch abändern in:
Nicht für die Schule lernen wir, sondern dafür, andere, die uns wichtig sind, nicht zu enttäuschen. Schon hier wird deutlich, wie wichtig Beziehungen in unserem Leben sind, besonders aber in der Kindheit und Jugend, in denen wir nach Menschen gesucht haben, die uns gut finden bzw. gut finden sollten.
Kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges emigrierte der Arzt und Psychoanalytiker Michael Balint (1896–1970) nach Großbritannien. Dort arbeitete er u.a. an der Frage, warum Patient:innen mit gleichen Krankheiten bei unterschiedlichen Ärzt:innen unterschiedlich schnell genesen.
Ergebnis dieser Forschungen war die Erkenntnis, die heute fast Allgemeingut geworden ist, dass die Beziehung zwischen Ärzt:in und Patient:in einer der wesentlichsten Genesungsgründe ist. Balint entwickelte dann sogenannte Balint-Gruppen, in denen es immer darum geht, die Beziehung zweier Menschen zu »diagnostizieren«, z.B. der Frage nachzugehen, was macht die andere mit mir und was mache ich mit der anderen. Solche Gruppen wurden zunächst für englische »Sozialassistent:innen« eingerichtet, später folgten Gruppen für Ärzt:innen, Seelsorger:innen, Richter:innen usw., also alles Berufe, in denen menschliche Beziehungen eine große Rolle spielen.
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass es erst verhältnismäßig spät solche Gruppen für Lehrer:innen gab, obwohl gerade Lehrpersonen, im Gegensatz zu den bereits zitierten Berufsgruppen, jederzeit in einem Wust von Beziehungen agieren, die ihnen in den seltensten Fällen in ihrer ganzen Tragweite bewusst sind.
Kinder und Jugendliche haben oft ein noch feineres Gespür dafür, ob Lehrer:innen nur freundlich tun und eigentlich gar kein Interesse an einem haben, oder ob diese Personen einen »ungerecht« behandeln, oder, was beinahe noch schlimmer ist, einen so behandeln, als wäre man jemand ganz anderes.
Quellen meines Handelns
Wie oft handeln Lehrer:innen nach dem Motto »Wehret den Anfängen«, weil sie glauben, eine Bedrohung ausgemacht zu haben, die von dem Betroffenen aber nicht verstanden wird. Darüber hinaus spielen in unsere Beziehungen eigene Lebenserfahrung hinein.
»Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Meinungen, die wir über die Dinge haben« (Epiktet). Hier stellt sich beispielsweise die Frage danach, wie hoch der Anteil unseres Handelns ist, der sich aus unseren anderweitigen Erfahrungen ergibt und mit der aktuellen Person gegenüber nur bedingt zu tun hat.
All dies sind Elemente einer Beziehung, die in solchen Supervisionsgruppen Bestandteil einer Beziehungs-Diagnose sind und die helfen, mein Bild der ande- ren, das ja mein Handeln bedingt, einmal zu reflektieren.
Ein Fallbeispiel
Eine Klassenlehrerin sollte im laufenden Schuljahr aus der Parallelklasse einen Schüler übernehmen, der sich in seiner bisherigen Klasse der dortigen Lehrerin gegenüber sehr aggressiv geäußert hatte. Die Lehrerin äußerte in der Gruppe die Angst, dass es ihr genauso ergehen könnte wie der Kollegin. Sie kam auf die Idee, von vornherein diesem Schüler gegenüber deutlich zu machen, dass er das mit ihr nicht machen könnte. In diesem Falle hätte die Lehrerin auf etwas reagiert, was noch gar nicht passiert war. Sie hätte durch dieses Verhalten wahrscheinlich genau das provoziert, was sie eigentlich vermeiden wollte.
So wurde in der Gruppe u.a. die Frage diskutiert, warum ein Schüler wohl so massiv eine Lehrerin angeht, wenn er nicht das Gefühl hatte, sowieso nichts mehr verlieren zu können. Aufgrund der Gruppendiskussion entschloss sich die Lehrerin, den »neuen« Schüler genauso zu behandeln wie alle anderen Schüler auch. Wochen später teilte die Lehrerin der Gruppe mit, dass der neue Schüler eine Bereicherung der Klassengemeinschaft sei und sie keinerlei Probleme mit ihm habe. Was wäre wohl ohne die Reflektion in der Gruppe passiert?
Gute Beziehung als Grundlage
Gehen wir davon aus, dass Schüler:innen vor allem für die Lehrer:innen lernen, die ihnen eine positive Beziehung anbieten, was Eltern oft bestätigen, dann wird deutlich, wie entscheidend solche Beziehungen sind. Fragt man Schüler:innen nach Lieblingsfächern oder nach Fächern, in denen sie besonders gut sind, dann kommt immer wieder, dass die betreffende Lehrer:in gut, o.k. oder in Ordnung sei.
Daraus ergibt sich die Frage nach Henne oder Ei. War zuerst die aufbauende Beziehung durch die Lehrperson da, oder war zunächst die Schüler:in fleißig und ihre Arbeit wurde dann entsprechend gewertet. Egal was zuerst war, es geht nicht ohne die gute Beziehung.
Vordefinierte Schubladen als Ordnungshilfen
Lehrer:innen, die sich in Balint-Gruppen – oder auch anderen Formen von Fallbesprechungsgruppen – mit Beziehungen auseinandersetzen, erleben oft erstmals, dass eine solche Beziehungsdiagnose Zeit und Arbeit erfordert.
Der Schulalltag oder die Unterrichtssituation verlangt aber eine schnelle Einordnung des Geschehens, um zeitnah reagieren zu können. Dass dabei das beobachtete Verhalten in vordefinierte Schubladen eingeordnet wird, ist kein Versagen der Lehrer:in, sondern spricht eher für ein Ordnungssystem, das ein »Überleben« in der Unterrichtssituation erst ermöglicht.
Vor Jahren ging eine Untersuchung der Frage nach, wie viel Ereignisse in der gleichen Richtung passieren müssen, damit wir daraus eine Regel machen. Das Ergebnis war verblüffend und gleichzeitig alarmierend: Nur 27 Prozent gleichartiger Erlebnisse genügen uns Menschen, um daraus die Lehre zu ziehen, dass es immer so ist. Wie schnell ist demnach eine Schüler:in, der z.B. gerade mit der Welt – sprich ihren Eltern, Lehrer:innen oder Freund:innen – hadert, in einer Schublade (patzig, unhöflich, unfreundlich), aus der er dann sobald auch nicht wieder rauskommt.
Beziehungswandel: Folge einer veränderten Sicht
Eine Supervisionsgruppe ermöglicht es oft erstmalig, sich die Zeit zu nehmen, genauer hinzusehen und verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Dabei ist es für Lehrer:innen oft schwierig, sich auf diese Zeit einzulassen und die gewohnten Zuordnungen zu vergessen. Im Gegensatz zu manch anderen Fallbesprechungsgruppen soll es in einer Balint-Gruppe keine Ratschläge geben, wie weiter vorgegangen werden soll. Dennoch kommen Lehrer:innen oft später und berichten, dass sich das Verhältnis zu der Schüler:in gebessert habe, obwohl man sich nicht anders verhalten habe als sonst. An dieser Stelle kann man beinahe daran fühlen, dass eine solche Veränderung nur Folge einer veränderten Beziehung sein kann.
Auch hier gilt, dass sich kein Mensch noch genauso wie vorher verhalten kann, wenn er eine andere Sichtweise eines Tatbestandes gewonnen hat.
Balint hat einmal von der »Droge Arzt« gesprochen und damit sagen wollen, dass das Verhalten der Arzt:in wie ein Medikament wirkt. Übertragen auf die Schule ergibt sich die Frage, wie viele schlechte Schüler:innen »gesunden« könnten, wenn sich auch Lehrer:innen häufiger bewusst wären, welche Einflussmöglichkeiten sie auf Schüler:innen haben und wie sehr dies von der jeweiligen Beziehung – sprich dem eigenen Verhalten – abhängt.
Supervision bei Gruppenthemen
In diesem Zusammenhang ist noch ein anderer Aspekt wichtig. Wird über eine Zweier-Beziehung gesprochen, so ist dies ein Problemfeld, in dem jeder handeln kann. Statt Resignation wird die Erfahrung gemacht, dass man selbst etwas verändern bzw. bewirken kann. Geht eine Supervision aber über eine Zweierbeziehung hinaus, z.B. eine ganze Klasse wird Gruppenthema, dann stößt man sehr schnell auf äußere Einflussfaktoren, denen eine einzelne Lehrer:in oft machtlos gegenüber steht. Die täglichen Diskussionen in Lehrer:innenzimmern verstärken dies noch, da es auch oft um Dinge geht, über die man keine Macht hat, die einen also machtlos zurücklassen.
Zufriedenheit im Beruf ist ohne das Gefühl, etwas bewirken zu können, oft nicht erreichbar. Supervision zeigt Wege dazu auf.
Eine Frage, die keine sein sollte
Es stellt sich die Frage, was sinnvoller ist:
- sich einzulassen auf oft jahrelange Auseinandersetzungen mit bestimmten Schüler:innen – bis hin zu der Fantasie, wie schön das Lehrer:innenleben sein könnte, wenn dieser Schüler:innen die Schule doch verließe oder zumindest sitzen bleiben würde – oder
- eine intensive Auseinandersetzung mit der Beziehung zu diesem Schüler zu führen, die das Problem im besten Falle erledigt, einen auf jeden Fall aber zufriedener zurücklässt, weil man nach Möglichkeiten zur Veränderung gesucht hat.
Wichtig ist dabei, eine solche Suche möglichst nicht mit den Kolleg:innen zu betreiben, die z.B. die Schüler:in genauso nervig finden, sondern mit fremden Kolleg:innen, die sich freiwillig auf den Fall einlassen, weil auch sie daraus etwas mitnehmen möchten.
Und nicht zuletzt ist es für alle Beteiligten spannend, die Vielfalt möglicher Hintergründe und Verwicklungen zu entdecken.
Folgt man dem bisher Gesagten, so ist kaum zu verstehen, warum Institutionen, die sich dem Lehrberuf verpflichtet fühlen, nicht mehr Hilfe in dieser Richtung für Lehrerinnen und Lehrer anbieten. Die Nachfrage ist groß.
Fazit
Da viele Lehrer:innen zwar schon von Supervision gehört haben, aber dennoch oft nicht so genau wissen, was darunter zu verstehen ist, empfiehlt es sich, eine Einführungsveranstaltung für das ganze Kollegium zu diesem Thema anzubieten, möglichst mit Supervisionsangeboten (einschließlich Kosten und Zeiten), z.B. der schulpsychologischen Dienste oder von örtlich ansässigen Diplom-Psycholog:innen. In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass eine Gruppe, die aus einem Kollegium kommt, problematisch ist, da eine solche Konstellation von vielen Teilnehmer:innen als zu eng erlebt wird. Dieser Befürchtung begegnet z.B. eine kollegiale Fallbesprechungsgruppe mit stärkerer Reglementierung.
Literatur
- Balint, Michael (1962): Der Arzt, sein Patient und die Krankheit. Stuttgart: Klett-Cotta (10. Aufl. 2001)
- Ehinger, W./Hennig, C. (1994): Praxis der Lehrersupervision. Weinheim: Beltz
- Gudjons, H. (Hrsg.) (1993) : Pädagogik, 1. Beiheft: Psychoanalyse und Schule. Weinheim: Beltz
- Roth, J. K. (1984): Hilfe für Helfer: Balint-Gruppen. München: Piper
- Schlee, J. (2008): Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Berufe: Hilfe zur Selbsthilfe. Stuttgart: Kohlhammer
Kuhlmann (2009) Beziehungsdiagnose: Warum Supervision für Lehrerinnen und Lehrer? (pdf)